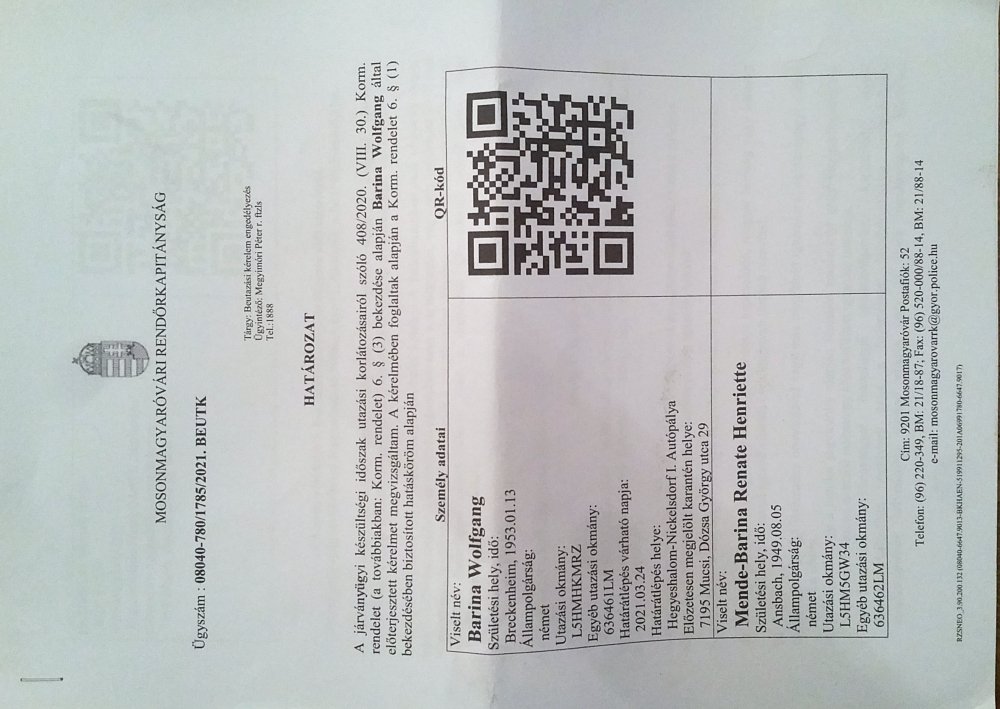Mucsi, den 25. März 2021
„Das Brot ist geknetet und geht vor sich hin. 100% Roggen, angesetzt mit Sauerteiggranulat und einer Spur Trockenhefe, dazu neben anderen Gewürzen und Sonnenblumenkernen ein ordentlicher Löffel Pulver vom Schabziegerklee (auch „Brotklee“) und Fenchelsamen, der südtiroler Einschlag ist gewünscht.“
So würde die zweite Staffel der Tagebuchreihe „Kantina Karantena“ beginnen, wenn wir nicht damit beginnen müssten, unseren derzeitigen Status zu schildern und mit dem geneigten Leser – während in der Küche das Brot geht und später gebacken werden will – zu vereinbaren, dass eine „Kantina Karantena“ auch dann eine Kantina Karantena sein darf, wenn gar keine Quarantäne offiziell angeordnet ist. Wir sind nämlich irgendwie in der Schwebe, in einer Art „vielleicht-aber-auch-nicht-oder-doch-Quarantäne“. Am Tor hängt kein Warnschild.
Dabei wähnten wir uns eigentlich auf der sicheren Seite und sind den Ratschlägen des deutschen Auswärtigen Amtes nachgegangen, das dringend empfiehlt, für Ungarn auch dann eine schriftliche Sondererlaubnis für die Einreise einzuholen, wenn wir eigentlich ansonsten mit unseren, im letzten Jahr für den Fall der Fälle noch schnell beantragten ungarischen Wohnsitzpapieren auch direkt einreisen könnten. „Es werden strenge Einreisekontrollen durchgeführt“. Gesagt, getan. Das Formblatt „COVID-06“ kann online und in Englisch eingereicht werden. Damit dann bereits erfasst sind Namen, Ausweisnummern, Ort der späteren Quarantäne, Einreisedatum, Grenzübergang, Autokennzeichen, zuständiges Polizeirevier für die Überwachung der Quarantäne. Nach 6 Tagen wiehert der Amtsschimmel in der Mailbox und bringt einen positiven Bescheid auf 5 dicht mit amtsjuristischem Ungarisch bedruckten Seiten mit sehr hoher „§“-Zeichen-Dichte. Aber die Sache ist schon klar: wir dürfen kommen, müssen aber (wieder) in Quarantäne, die von den gleichen Herren überwacht werden wird, die schon im vergangenen Jahr (Polizei Tamási) aufgepasst haben, an der Grenze wird eine Gesundheitsuntersuchung vorgenommen usw. usf. Und die Digitalisierung galoppiert: eingangs des Schreibens, das an der Grenze vorzuweisen ist, prangen zwei fette Bar-Codes und wir gehen davon aus, dass die später an der Grenze eingelesen werden und der Schimmel weitergaloppiert und beim zuständigen Polizeirevier Bescheid gibt, dass wir kommen und überwacht werden müssen.
Nach Eingang dieses Schreibens arbeiten wir noch in Frankfurt unsere XXXLLXXXL-Lebensmittelliste ab und packen das Auto.
Und zwar noch voller als im vergangenen Jahr, weil wir heuer auch nach der Quarantäne nur eher im Notfall in einen Supermarkt gehen wollen. Tagesaktuell ist die Corona-Situation in Ungarn und auch direkt hier im Dorf um uns herum nicht sehr prickelnd. Nicht nur gesundheitlich. Der gestrenge Staat verdonnert zusätzlich zum ohnehin vorhandenen Elend seine lieben Untertanen auch zu Geldbußen für das Nichttragen einer Maske in der Öffentlichkeit, die deutlich über dem liegen, was ein Teil unserer Dörfler hier monatlich als Grundsicherung einstreichen darf. Solches und auch das eigenmächtige Nichteinhalten der Quarantäne ist übrigens auch für Ausländer mit hoher Geldstrafe bewehrt, weswegen wir uns eben die einleitend geschilderten Gedanken machen und die Speisekammer mit Vorräten füllen.
Das Auto ist also gepackt. Wir reisen in Frankfurt ab, durch Österreich durch und nach Ungarn ein. Ab, durch, ein? War da was? Warum sind wir jetzt schon drin? Hinter Passau in Suben schielt der österreichische Grenzer nur aus der Ferne auf unsere deutschen Ausweise und winkt durch. Knapp vier Stunden später steuern wir als einziger PKW im Schritttempo auf die ansonsten verwaiste ungarische Grenzkontrollstelle auf der Autobahn bei Hegyeshalom zu, innerlich bereit, streng(!) einreisekontrolliert und sofort gescannt zu werden. Schildkappe ist schon nach hinten geschoben, das digitale Fieberthermometer hat freien Zugang zur Stirn, die Gesundheitsprüfung kann ihren Lauf nehmen.
Aber hat das eigentlich auch jemand dem diensthabenden Beamten gesagt? Bevor wir diese Frage beantworten – wie jetzt natürlich nicht mehr anders zu erwarten mit einem klaren „NEM“ (ung. „nein“) – schieben wir sicherheitshalber noch etwas ein, mit dem wir uns am Ende selbst erklären wollten, was da passiert ist. Was ist ein „Hungaricum“? Ein „Hungaricum“ ist ein schützenswertes nationales ungarisches Erzeugnis – z.B. der Kräuterlikör „Unicum“ – oder eine typisch ungarische kulturelle Errungenschaft – wie z.B. dass die Männer einmal im Jahr Gulasch im Kessel über offenem Feuer kochen. So eine kulturelle Errungenschaft ist auch das tägliche Mittagessen um 11:30 Uhr, spätestens 11:45 Uhr. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben kommt um diese Uhrzeit weitgehend zum Erliegen. Das Land ist kollektiv unterzuckert und strebt in die Kantinen und Garküchen. Wir fahren auf den Grenzer so knapp vor 11:30 Uhr zu, sein Blick ist etwas glasig, Hirn und Grenzschutz versagen bereits weitgehend. Corona ist ein mexikanische Bier, Quarantäne ein lateinisches Fremdwort. Er fragt, ob wir Ungarn seien, wir outen uns als Deutsche. Er murmelt etwas auf Ungarisch, das wir nicht verstehen, und dreht ab. Ob er die hingehaltenen Papiere wahrgenommen hat, ist schwer zu beurteilen. „Sie können …..“, ja was bitte? Weiterfahren? Wir rollen los und suchen das Gelände ab nach einem Schalter, an dem man sich vielleicht registrieren kann, darf, muss, soll. Er kommt nicht hinterher gelaufen, kein Blaulicht blinkt auf, keine Sirene heult, als wir zögerlich und mit nur langsam zunehmender Geschwindigkeit auf die Autobahn gen Budapest rollen.
Sind wir jetzt in Quarantäne? Schwer zu sagen. Aber auch egal. Wir hätten sie uns ja auch selbst verordnet. Ein wenig misslich nur die Ungewissheit, dass wir nicht wissen, ob wir vielleicht selbst etwas falsch gemacht haben. Das können die „streng“ regierenden, authoritären Systeme ja ganz gut: verunsichern. Der Grenzer war eben ein Profi. Wir wollen aber auch nicht fragen („Gehe nicht zu Deinem Fürst ….“) und warten mal ab, ob wer vor dem Tor vorfährt und kontrolliert. Bislang Fehlanzeige.
Lange Rede, kurzer Sinn: die neue Staffel unserer kulinarischen Berichte kommt gewissermaßen jetzt aus der Pseudo-Quarantäne und zählt die Tage nicht wie beim letztem Mal mechanisch herunter bis wir wieder „frei“ sind. Es wird taktmäßig etwas lockerer zugehen.
Aber immerhin ist in der Zwischenzeit das Brot fertig geworden.
Wie eingangs angedeutet, eigentlich kein Wunderwerk, auch wenn es manchem, der gerade anfängt Brot zu Hause selbst zu backen, so vorkommen mag, weil die Küche eben mal aussieht wie eine Mehlkleisterfabrik. Es braucht aber doch eine gute Weile, bis man das richtige Gefühl für die Zutatenproportionierung, die Arbeitsschritte und die richtigen Zeitpunkte beim Teig gehen lassen und ausbacken entwickelt. Davon hängt am Ende die Porung ab, also die Größe und Verteilung der Lufteinschlüsse im Brotteig. Schnell wird so ein Brot sonst gerne auch zum Luftpolsterkissen oder zum Backstein.
Für dieses Brot haben wir am Morgen einen Vorteig gemacht aus
300 gr Roggenmehl 1150
1 Päckchen Trockenbackhefe (7 gr)
1 Päckchen Trockensauerteig (15 gr)
1 Miniprise Zucker (optional)
300 ml lauwarmem Wasser.
Sorgfältig wenigstens 10 Minuten mit dem Handrührgerät oder in der Küchenmaschine kneten. Danach abgedeckt an einem nicht zu kalten Ort gehen lassen. Gerne mehrere Stunden, Brot braucht viel Zeit. Zumal Hefe und Sauerteig in den Angaben oben bewusst unterdosiert sind und damit länger arbeiten müssen. Nicht von den Angaben auf der Hefepackung irritieren lassen, die sind auf „turbo“ ausgelegt, also auf Brot in 60 Minuten.
Im zweiten Schritt haben wir am Nachmittag dem Vorteig zugefügt
400 gr Roggenmehl 1150
18 gr Salz, aufgelöst in
300 ml lauwarmem Wasser
1 EL Schabziegerkleepulver (Brotklee)
1 EL gemahlener Koreander
1 El Fenchelsamen
eine Handvoll Sonnenblumenkerne.
Erneut sehr gut wenigstens 10 Minuten durchkneten und in eine dünn geölte und dann ausgemehlte Kastenform geben. Diese sollte zu nicht mehr als zwei Dritteln gefüllt sein, sonst eine größere oder eine zweite verwenden. Oben gut mit Mehl bestäuben. An einem nicht zu kalten Platz abgedeckt (2 gefaltete Geschirrtücher) so lange gehen lassen bis der Teig bis fast über der Rand gestiegen ist. Hier jetzt nicht ungeduldig werden, außerdem darauf achten, dass es keine starken Temperaturwechsel gibt, sonst fällt alles wieder zusammen. Wenn man den Eindruck hat, dass der Teig aufgehört hat zu gehen und von selbst wieder leicht einsinkt, schnell in den auf 250 Grad vorgeheizten Backofen schieben. Tür zu. Etwa eine Stunde bei „fallender Temperatur“ backen, also gelegentlich immer mal 20 Grad runterschalten. Oder gleich nach Einschieben auf 200 zurückgehen und so durchlaufen lassen. Wenn das Brot oben braun wird nach kurzem Abkühlen aus der Form nehmen. Sollten die Seiten noch nicht überzeugen und das Brotlaib noch etwas „weich“ wirken, das Brot gerne noch einmal für eine Weile zum Nachgaren in den bereits ausgestellten Backofen geben. Fertig.
Zum Abendessen gab es nebenbei erwähnt Kalbsbacken mit gebratenen Zucchini.
Rezept entfällt, wir haben nur warm gemacht. Es gibt mittlerweile gerade auch für gehobenere Ansprüche quarantäne-fähige Fertigware, sehr schmackhaft, ohne jegliche Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker aus dem Supermarktregal. Da muss man sich nicht genieren.
Mahlzeit und bis zum nächsten Mal!
PS: Unterwegs haben wir noch frisches Gemüse gekauft und bei einer Zwischenübernachtung in Passau im Bad gewaschen.
Und dort liegen die Zwiebeln immer noch.